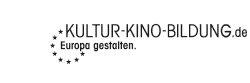Eric Lanz
Vom Wesen der Dinge
Ein Antagonismus eigentlich, als Teil der Fragestellung: Eric Lanz schildert das sinnliche Erleben überwiegend profaner Dinge, die taktile Erfahrung ihrer Berührung mit den Händen, den Fingern und die Vorstellung davon im konzentrierten Hinsehen. Aber er wählt dazu als Methode die neuen Medien, die glatte Oberflächen anbieten und sich dem direkten Zugriff entziehen. Er arbeitet, überwiegend analog, mit Video, Videoinstallation und Fotografie und Scan-Verfahren. Sein Vorgehen ist komplex. Bewegungen und materielle Prozesse sind verlangsamt oder beschleunigt oder werden rückwärts abgespielt. Teils passiert das in vollständiger Stille, teils sind die Geräusche der Handlungen und Bewegungen beiläufig zu hören. Die Objekte und Substanzen sind in Ausschließlichkeit gegeben, auch wenn sie von einer liquiden Materie umgeben sind, aus der sie sukzessive auftauchen und Raum einnehmen und dann wieder versinken. Oder wenn sie durch den händischen Zugriff gewendet und auseinandergenommen oder mit dem Licht eines Scanners – also aus nächster Nähe, erneut wie eine Berührung – Abschnitt für Abschnitt durchleuchtet werden. Sie sind teils vergrößert und außerhalb ihres Kontextes wiedergegeben und dadurch weiter abstrahiert und sind dazu in Bewegung, Veränderung und Ausdehnung begriffen, so dass Gewebe und Konsistenzen erfahrbar sind und bis zum Zerreißen gespannt werden. Die Dinge entäußern sich, ganz selbstverständlich und rätselhaft zugleich.
Derzeit ist im Leverkusener Museum Morsbroich ein umfassender Einblick in das Werk von Eric Lanz zu sehen. Schon die früheste Videoarbeit „Les Matières (solides / liquides)“ (1991) vermittelt Wesentliches von dem, was für ihn auch heute kennzeichnend ist. Ausgangsidee bei „Les Matières“ ist der Touchscreen, der als Medium der digitalen Interaktivität in dieser Zeit populär wurde. Ein Raster teilt die Bildschirmflächen von zwei Monitoren in neun Felder. Im Vordergrund, sozusagen von draußen hineinlangend, aktiviert jeweils eine Hand eines der Felder. Hinter dem einen Raster klopft daraufhin eine weitere Hand an die imaginäre Fläche, wechselnd zwischen höflicher Zurückhaltung und energischer Forderung. Beim anderen Monitor greift eine Hand in eine liquide, zähflüssige oder körnige Substanz. Sie nimmt sie auf, lässt sie aus dem Handteller rieseln und reibt sie mit den Fingerspitzen auf der Haut ein. Die Monitore zeigen verschiedene Zugriffe auf die Welt: vor und hinter dem Interface, aus der Distanz und im direkten Aneignen. Die Berührung auf dem Touchscreen wird zum auslösenden Impuls und spricht auf einer übertragenen Ebene die Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung wie bei Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle an. Hier nun erschafft sich der Mensch mit den neuen digitalen Optionen eine eigene, aber doch künstliche, illusionistische Welt. Befragt wird implizit, was zugleich mit den neuen digitalen Möglichkeiten an Sinnlichkeit und Lebendigkeit verloren geht – und welche physische und emotionale Relevanz die direkte Berührung durch die Hände und Finger für unsere Weltsicht besitzt. In der Leverkusener Ausstellung widmet sich die Videoarbeit „Choses 1 (Dinge 1)“ (1999) dem Erlebnis der unmittelbaren, intimen, dabei wie selbstverständlichen Aneignung. In zügiger Abfolge sind ganzflächig verschieden gelbliche und sodann rötliche Substanzen, Materien und Objekte zu sehen, auf welche die Hände zugreifen und sie abtasten, kneten, reiben oder verformen. Dabei handelt es sich etwa um Schaumstoff, Teig, Senf, Holz, ein Baumblatt sowie Wolle, Leber, die menschliche Zunge und Haut.
Mithin geht es noch darum, sich unserer körperlichen Existenz und der Erscheinungsformen unserer alltäglichen Umgebung zu vergegenwärtigen. Eric Lanz holt Dinge hervor, die wir in ihrer Beschaffenheit und Struktur, Tönung, Oberfläche, Konsistenz, ihrem Gewicht und den Prozessen, die sich in ihnen abspielen, kaum wahrnehmen, auch wenn wir uns auf sie einlassen. Und immer sind es – neben dem Sehsinn – die Hände und vor allem die Fingerspitzen, welche die Erfahrung ermöglichen. Vielleicht klingt auch an, dass der handwerkliche Zugriff in unserer Gegenwart mehr und mehr zurückgedrängt wird und andere, digitale und virtuelle Realitäten an die Stelle der „wirklichen“ Aktivität treten. Die Vorstellungen und Empfindungen (die letztlich aufgrund eigener Erlebnisse möglich sind) hat Lanz dann in weiteren Videos sinnlich veranschaulicht, die – auch hier ausgehend vom Touchscreen, nun mit alternativen Tools, die anzuklicken sind – etwa zeigen, wie Nahrungsmittel mit dem Skalpell aufgeschnitten, geöffnet und vernäht werden: vor unseren Augen und emotional so berührend als seien wir Zeugen einer chirurgischen Operation.
Eric Lanz wurde 1962 in Biel geboren. Er hat zunächst an der École Supérieure d‘Arts Visuels in Genf studiert und ist anschließend, 1986-88, an die Kunstakademie Düsseldorf, in die Klasse von Nam June Paik gewechselt. Ihn habe gereizt, mit innovativerem Equipment als in Genf zu arbeiten, sagt Lanz. Hinzu kam die Persönlichkeit von Paik, auch wenn dieser gar nicht so häufig in Düsseldorf gewesen wäre. Einen tieferen Einblick in seine Arbeit hat Lanz erhalten, indem er einige Jahre zum Team gehörte, das seine Ausstellungen eingerichtet hat. Seit 2010 hat er selbst eine Professur für Video und künstlerische Fotografie an der HBK Saar in Saarbrücken inne, lebt aber weiterhin in Düsseldorf und hat hier durchgehend ausgestellt, unter anderem in den Galerien von Thomas Taubert und Ruth Leuchter, im Kunstraum Himmelgeisterstrasse und in der Videolounge des imai. - Vielleicht aber verbindet das akribische und zugleich forschend spielerische, experimentelle Interesse an den Dingen, die von allen Seiten betrachtet und teils typologisch erfasst werden, sich verändern und sogar Kettenreaktionen auslösen, das Werk von Eric Lanz mit einzelnen Haltungen in seiner Schweizer Heimat, mit Roman Signer und Fischli & Weiss.
Die sukzessive Transformation des rätselhaft Sichtbaren, bei der schließlich nichts mehr ist wie es war und sich assoziativ neue erstaunliche Bezüge und Evokationen zu unserer faktischen und medial vermittelten Realität einstellen, zeichnet die beiden großformatig projizierten Videoarbeiten „Morphing“ (zwei parallel aneinander anschließende Videoprojektionen, 2007) und „Loom“ (Videoinstallation aus einer Projektion und zwei Monitoren, 2025) aus. Schon das: In der sacht kontinuierlichen Veränderung von Objekten und Materie wirken sie streckenweise, aufgenommen wie aus der Vogelperspektive, als würde es sich um Inseln handeln, auf denen ein Vulkan ausgebrochen ist oder als würden sie allmählich im Meer versinken. Indirekt spricht er den Wandel des Klimas und die Zerstörung der Erde an. Tatsächlich zeigt Eric Lanz Langzeitprozesse des Verfalls oder der Deformation von natürlicher Materie, die, im Atelier entwickelt und dokumentiert, nun beschleunigt, als Morphing und rückwärts abgespielt werden, so dass ein Anwachsen und Stabilisieren zu sehen ist, welches die Wirklichkeit, die sich in der Realität dem bloßen Auge entzieht, ad absurdum führt. Bei der Videoinstallation „Fugen“ (2012) mit drei hochformatigen Projektionen, bei denen die Buntfarben weitgehend herausgefiltert sind, stellen sich Phänomene ein, die an Wasser erinnern, etwa wie ein Wasserfall in die Tiefe sprudeln oder als Eis schmelzen. Auch hier macht das Ungewisse einen Reiz aus: die Vielschichtigkeit und die Möglichkeiten der natürlichen Phänomene, die zu Ereignissen werden und in ihrer Schönheit auch reines Staunen auslösen.
Von Aufscheinen und Verschwinden, der Klarheit des Lapidaren und den plötzlichen Geheimnissen inmitten der Fokussierung, die noch die Oberflächen und Konturen ertastet und so unbeachtete Strukturen sichtbar macht, handelt auch, unter Mitwirkung von Eric Lanz selbst, die Arbeit „durchgehend“ (2015). Diese wurde als Aktion im Rohbau des Neubaus der Modernen Galerie in Saarbrücken aufgenommen. In zwei über Eck aufeinandertreffenden Projektionen durchquert Eric Lanz im Dunkel die Räume aller Stockwerke, einen Rollkoffer hinter sich herziehend, welcher mit einem Licht als einziger Beleuchtung versehen ist. Die Handlung setzt sich von der einen Projektion in die andere fort. Mitunter wechselt Eric Lanz die Richtung, zu hören sind das Schlagen der Türen und die Räder des Koffers. Mit seinem wechselnd hellen Schein beleuchtet dieser nacheinander die einzelnen Raumausschnitte, für einen kurzen Moment: Das Raumgebilde entsteht und fällt wieder in sich zusammen. Manchmal wirkt das Licht gleißend strahlend, dabei formlos, vielleicht wie Feuer. Mit dem Instrumentarium des heutigen global nomadisierenden Menschen klingen in der labyrinthischen Anmutung archaische Mythen und elementare Zustände des Lebens an.
Im Umgang mit dem Licht bezieht sich Eric Lanz im Grunde auf das Verfahren des Scans, welches er seit einigen Jahren auch für das Erfassen von Objekten einsetzt: als Videoaufzeichnungen, darin vergleichbar Röntgenaufnahmen, und als fotografische Bilder. So erfasst er Handschuhe und druckt die Aufnahmen zentriert auf neutralem Grund aus, wobei sie eine außerordentliche plastische Körperlichkeit annehmen und mit uns zu kommunizieren scheinen. Die Handschuhe entstammen einer Sammlung von 300 Paaren aus ganz verschiedenen Anwendungsbereichen, die er in den frühen 1990er Jahren zusammengetragen und schon da für seine Arbeit verwendet hat. Handschuhe entziehen dem direkten Berühren und schützen die Hände, werden selbst mit ihrer eigenen, unterschiedlich dünnen Haut zum Interface und sind zu unterschiedlichem Gebrauch geeignet. Bei Eric Lanz befinden sie sich in verschiedenen Erhaltungszuständen bis hin zum Verwitterten, Beschädigten, das noch die Spuren seiner ursprünglichen Verwendung trägt. Plötzlich werden ihre eigene Materialität und ihre Geschichte interessant, auch als Hinweis auf eine Vergänglichkeit, stellvertretend noch für Berufe, die durch technisierte anonyme Prozesse ersetzt werden. Die Handschuhe sind Prothesen, sagt Eric Lanz. Sie übernehmen die Kontaktaufnahme aus der bitteren Erkenntnis heraus, dass wir, hilflos beobachtend, die Beziehung zur physisch-materiellen Welt verlieren – also nicht nur zu den Dingen, sondern auch ihrem realen Erleben.
Eric Lanz: zusehends, bis 10. August im Museum Morsbroich in Leverkusen, Di-So 11-17 Uhr. Außerdem ist er beteiligt bei: „Frauebrür,“ im space-o, 27.4.-31.5. Atelierhaus Oberhausener Str. 15 in Düsseldorf
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
AGDSTILLLEBEN MIT KNÜPPEL, 2025 von Jonathan Ungemach
Innen und Außen
Raimund Abraham auf der Raketenstation Hombroich
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„HILDEGARD VON BINGEN“, 2024 von Heinke Haberland
Elisabeth Mühlen
Stille Sensationen
Rhythmus und Licht
Günther Uecker in der ZERO foundation
Düsseldorfer Nacht der Museen 2025
26.4.2025 Eine Stadt. Eine Nacht. Unendliche Möglichkeiten
FARBE UND LICHT. FOKUS AUF DIE SAMMLUNG
Die aktuelle Ausstellung im Museum Ratingen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„TYPEFACE: K“, 2022 von Hyeju Lee
Ein Jahr Galerie „Kiek ma rin“ in Erkrath
Ein Grund zum Feiern!
200 Jahre Düsseldorfer Karneval im Blick
Ulrich Fürneisen
Eine Landschaft
Schnell und entschleunigt
Harald Naegeli im Bilker Bunker
Kunst aus Verantwortung
Katharina Sieverding in K21
Ari Benjamin Meyers
Die Wirkung von Gesang
Jürgen Grölle
Assoziierte Landschaften
Avantgarde in der Malerei der sechziger Jahre
Konrad Lueg im Kunstpalast
Siegfried Anzinger
Mit der Figur
Fortschritt in der Fotografie
Thomas Ruff im neuen Malkastenforum
Ralf Brög
„JEL_Dreamer“, 2021
Theresa Weber
Identität und Identitäten
Fließend und weich
Sheila Hicks in Düsseldorf
Jakob Albert
„SHIP 5“, 2024
Stefan à Wengen. The Power of Love
bis 26.1.2025 im Museum Ratingen
Anys Reimann
Vielstimmig im einen
Zukunft ist jetzt
Die Schenkung v. Florian Peters-Messer im Kunstpalast im Ehrenhof