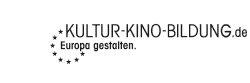Rosemarie Trockel
Andere Perspektiven
Fast schien es, als würde Rosemarie Trockels 70. Geburtstag im vergangenen November still vorübergehen, also so, wie die international geachtete, dabei eher zurückhaltende Künstlerin es sich möglicherweise gewünscht hat. Weder in Köln, wo Trockel an der Werkkunstschule studiert und lange gelebt hat, noch in Düsseldorf, wo sie als Professorin an der Kunstakademie gelehrt hat, findet eine Ausstellung statt. Aber im Dezember hat in Frankfurt im Museum für Moderne Kunst eine Schau über drei Stockwerke eröffnet, die einen Überblick von den 1970er Jahren bis heute zeigt. Sie heißt wie die Künstlerin, mehr nicht, während die (Unter-) Titel ihrer einzelnen Werke oft sprechend sind und weitere Verstehens- und Interpretationsebenen öffnen. Überhaupt wird es in der Ausstellung in Frankfurt nie langweilig, sie ist im Wechsel von gegenständlichen, figürlichen und abstrakten Werken überraschend und von Raum zu Raum unerwartet. Sie zeigt, dass sich Trockel nicht auf einzelne Medien festlegen lässt, dazu einzelne Motive auch nach langer Zeit wieder aufgreift und etwa Fotografien mit Malereien kombiniert, und wie weit der Radius ihrer Themen und Sujets reicht. Im übrigen: dass ihre Werke mehrdeutig und ambivalent sind. Sie entlarvt vorgegebene gesellschaftliche Strukturen und Riten, aber da geht es erst los. „Es ist wie die Umkehrung des ethnologischen Blicks. Wo dieser Fremdes als verlorenes Eigenes besetzt, wird hier die bekannte Welt in interstellare Fremdheit gedrängt“, hat Ursula Panhans-Bühler schon 1997 in Trockels Sammlungskatalog des MMK Frankfurt geschrieben.
Mit ihrer Sensibilität, ihrem Gespür für gesellschaftliche, soziologische und soziale Fragestellungen, die oft eher totgeschwiegen werden, ihrer Reflexion der Zeitgeschichte, gehört Rosemarie Trockel zu den wichtigen Künstler*innen der Gegenwart. 1997 und 2012 wurde sie zur documenta eingeladen. 1999 hat sie im Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig ausgestellt; im vergangenen Jahr war sie an der dortigen zentralen Gruppenausstellung „The Milk of Dreams“ beteiligt. Schon 1988 hat sie im Museum of Modern Art in New York ausgestellt, weitere Einzelausstellungen fanden im Museum für Gegenwartskunst in Basel, in der Whitechapel Art Gallery in London, im Centre Pompidou in Paris oder im Moderna Museet in Malmö statt. Zu den Auszeichnungen, die sie erhalten hat, gehört der Kunstpreis der Landeshauptstadt Düsseldorf 2008. Aber auch als Professorin an der Kunstakademie Düsseldorf 1998 bis 2016 hat Rosemarie Trockel Spuren hinterlassen. Aus ihrer Klasse kommen etwa Kristina Buch, Thea Dzordjadze, Robert Elfgen, Gesine Grundmann, Michail Pirgelis.
Bekannt wurde Trockel früh mit ihren Werkgruppen der Strickbilder und der Herdplatten. Mit beiden befragt sie die Rollenzuweisung von Frauen in der Gesellschaft, aber auch im Kunstbetrieb. Ironisch unterläuft sie alle Erwartungen, schon indem die „Malereien“ aus Wolle, nach ihren Entwürfen, maschinell gestrickt sind. Trockel greift auf gegenständliche Motive und Signets zurück, ebenso wie sie monochrome Flächen konzipiert und so auf die Geschichte der reinen Farbmalerei anspielt und das Tafelbild in seiner Verfasstheit und Aktualität befragt – Überlegungen, die sie bis heute in ihren Werken aus farbigen Klebestreifen fortsetzt. Oder, darüber hinaus: eines dieser Bilder, und zwar aus blass blaugrauer Wolle, trägt den Titel „Menopause“.
Die Herdplatten auf ihrer weißen Aluminiumfläche, die im frontalen Gegenüber an der Wand hängen, sind wie aus der Perspektive der Nutzanwendung gesehen und erinnern vielleicht an die Minimal Art, überwinden diese aber in der freien Systematik der schwarzen Scheiben, die nun eher an die Punkte auf einem Würfel denken lassen. Im MMK in Frankfurt hängen zudem, in einem eigenen Raum, derartige Herdplatten von 2000, die, mit Kabel angeschlossen, glühend heiß werden.
Weitere Klischees, die mit dem Weiblichen verbunden sind und in ihrem Werk mitunter auf die Spitze getrieben werden, sind das gewaschene, gebügelte, gefaltete weiße Hemd, das Bügeleisen, die Frisur, das Thema der Verhütung, die Berufswahl – und damit die Gebundenheit der Person, auch was die Rolle als Künstlerin und die Erfolgschancen als solche betrifft. Daran könnte man gleich im ersten Saal im MMK in Frankfurt denken. „Prisoner of Yourself“, ein Wand füllender Siebdruck, zeigt ein locker geknüpftes blaues Gewebe, das die eigenen Strickbilder zitiert und demonstriert, dass es bei aller Löchrigkeit kein Entkommen gibt, auch nicht vor den Erwartungen an ihr künstlerisches Werk. Spannend ist, dass es Trockel in diesem Fall schließlich doch gelungen scheint, indem sie die früheren, bei ihr verbliebenen Wollbilder zerschnitten, gestapelt und unter einem Glassturz auf den Seiten sichtbar als ein einziges Objekt präsentiert.
Mit einer Mehrdeutigkeit, die sich aus den Rollenzuweisungen ableitet, „funktioniert“ ebenfalls „Notre-Dame“ (2018), eine Haarnadel, die mit einer Höhe von 2,90 m an der Wand lehnt. In ihrer Funktion selbst elegant und effizient, zähmt sie gemeinhin das Wilde der Haarpracht. Aber sie ist ebenso ein spitzer Gegenstand, der Türschlösser öffnet oder Menschen verletzt. In ihrer linearen Zeichnung erinnert sie zudem an ein stechendes Insekt und schließt im übrigen an das Konzept des Ready-made von Marcel Duchamp an, auf den Trockel in ihrem Werk wiederholt zurückkommt.
Tiere – immer wieder finden sich Tiere, als Opfer der Jagd etwa ein totes Reh, als gedankenlose Speise, für welche die Tiere brutal aus dem Leben gerissen werden – wie etwa die abgeformten und in Keramik gebrannten Fleischstücke aus dem Schlachthof – oder mit ihrer Nähe zum Menschen, etwa bei den Serien von Zeichnungen, so auch den Affenporträts. Dazu kommen die Studien über Stare oder Prozessionsspinner. Oder der Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm „L‘Hippocampe“ (1933) von Jean Painlevé, in dem das männliche Seepferdchen seine Jungen austrägt und nun umgekehrt jedes vorgefasste Bild der Biologie auf den Kopf stellt. Die über Kunstkreise hinaus vielleicht bekannteste Arbeit von Rosemarie Trockel ist 1997 gemeinsam mit Carsten Höller entstanden: Auf der documenta haben die beiden ein „Haus für Schweine und Menschen“ eingerichtet, das ein Plädoyer für eine Humanisierung der Tiere und ihre artgerechte Haltung war.
Die Ausstellung im MMK wendet sich zugleich dem dortigen umfassenden Sammlungsbestand zu ihrem Werk zu. Dazu gehören die in Bronze gegossene Robbe mit einem Halsband aus blondem Kunsthaar, die an einem Seil kopfunter von der Decke hängt (1991), und „Daddy‘s Striptease Room“ (1990) mit dem Holzmodell eines schwarz lackierten Doms in einem seitlich mit durchsichtiger Folie versehenen schäbigen Pappkarton, der mit seinen Aufdrucken an Bananenkartons und, ganz konkret, Kellogg‘s Cornflakes erinnert, aber durch eine Gruppe Sterne den Aspekt des Entertainment aufwirft: Der (männliche) Verwandte und Dominator wird zum Voyeur, und plötzlich braut sich aus den vielen Referenzen etwas Bedrohliches zusammen, das jedoch im Möglichen verbleibt. Direkter sind später die „Geruchsskulpturen“ (2006), bei denen auf einem Tisch aus glänzenden Kacheln ein einzelnes, in Segmente unterteiltes Kinderbein aus Keramik liegt, daneben steht ein mit Whiskey gefülltes Glas – Trockel benennt das Thema des Kindesmissbrauchs hier als Phänomen, das verdrängt und mit Alkohol heruntergespielt wird. Andere Werke befragen patriarchalische Strukturen, Altersdiskriminierung, den Klimawandel oder die Zustände im Gefängnis und politische Gefangene. Jüngst ist ein Foto-Tableau zum Krieg in der Ukraine entstanden: mit Wladimir Putin und Porträts von Soldatenwitwen.
Und doch öffnet sich dieses so komplexe, vielgestaltige Werk in alle Richtungen und nimmt neben der Betroffenheit über die entsetzliche Weltgeschichte ebenso kleine Tragödien und Abweichungen zum Anlass der Reflexion, die ebenso präzise umgesetzt ist wie sie über Humor bis hin zur Komik verfügt. Trockels Arbeit ist wahrscheinlich mehr autobiographisch als man ahnt und das betrifft ja auch das Belesene, die Hinweise auf die ihr wichtige Literatur, aber auch das eigene Aufwachsen mit der Rolle als Mädchen und junge Frau in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann ist vielleicht ein denkbar einfacher Videofilm der berührendste Beitrag im MMK. Darin berichtet „Julia, 10-20 Jahre“ (1998) von ihren Vorstellungen für das künftige Leben: „Man sollte vielleicht auch seine eigenen Erfüllungen haben, zum Beispiel Träumen oder Lesen“. „Ich bin gerne da, wo ich noch nie gewesen bin.“ „Ich denke oft, ich wollt, ich wär wieder ein Kind.“
Rosemarie Trockel
bis 18. Juni im Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main
www.mmk.art
Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
AGDSTILLLEBEN MIT KNÜPPEL, 2025 von Jonathan Ungemach
Eric Lanz
Vom Wesen der Dinge
Innen und Außen
Raimund Abraham auf der Raketenstation Hombroich
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„HILDEGARD VON BINGEN“, 2024 von Heinke Haberland
Elisabeth Mühlen
Stille Sensationen
Rhythmus und Licht
Günther Uecker in der ZERO foundation
Düsseldorfer Nacht der Museen 2025
26.4.2025 Eine Stadt. Eine Nacht. Unendliche Möglichkeiten
FARBE UND LICHT. FOKUS AUF DIE SAMMLUNG
Die aktuelle Ausstellung im Museum Ratingen
„Kunst-Stücke“ Anna Schlüters Blick auf
„TYPEFACE: K“, 2022 von Hyeju Lee
Ein Jahr Galerie „Kiek ma rin“ in Erkrath
Ein Grund zum Feiern!
200 Jahre Düsseldorfer Karneval im Blick
Ulrich Fürneisen
Eine Landschaft
Schnell und entschleunigt
Harald Naegeli im Bilker Bunker
Kunst aus Verantwortung
Katharina Sieverding in K21
Ari Benjamin Meyers
Die Wirkung von Gesang
Jürgen Grölle
Assoziierte Landschaften
Avantgarde in der Malerei der sechziger Jahre
Konrad Lueg im Kunstpalast
Siegfried Anzinger
Mit der Figur
Fortschritt in der Fotografie
Thomas Ruff im neuen Malkastenforum
Ralf Brög
„JEL_Dreamer“, 2021
Theresa Weber
Identität und Identitäten
Fließend und weich
Sheila Hicks in Düsseldorf
Jakob Albert
„SHIP 5“, 2024
Stefan à Wengen. The Power of Love
bis 26.1.2025 im Museum Ratingen
Anys Reimann
Vielstimmig im einen